Heute einmal etwas „unpolitisches” zur Unterhaltung:
Rezension: Johann Sebastian Bach
Geschmack ist vielfältig und wandelbar. Heutige Vielfalt von Stilrichtungen ist enorm. Dabei gibt es einen Höhepunkt, bei dem zwar nicht alle, aber viele Kenner übereinstimmen. Betrachten wir die Geschichte abendländischer Musik. Die Vorgeschichte liegt im Dunkeln mit spärlichen Überlieferungen. Einst wurden Sagen vorgesungen und mit Instrumenten begleitet. Von vorchristlicher religiöser Musik wissen wir noch weniger. Wir können von Ähnlichkeiten mit ethnischer Musik ausgehen, die wir aus anderen Weltteilen kennen.
Typisch für solche Musik ist folgendes: Oft baut sie auf Rhythmik und einstimmigem Gesang oder einstimmigen Melodien.
Das Christentum brachte einen Bruch mit früherer Kultur, nicht nur beim Glauben, sondern auch in der Musik. Prägend wurde Musik wie gregorianische Choräle.
Diese Musik zeichnete sich, vereinfacht gesagt, durch zunehmenden Verzicht auf Schlagzeug und Rhythmik aus, die vor allem durch die Melodie entsteht, und durch weitgehende Einstimmigkeit, mit Ansätzen zu einer neuen Art von Mehrstimmigkeit.
In jener Zeit galten nur wenige Töne als Harmonien: Oktaven, Quinten und schließlich Quarten, die in dieser Reihenfolge zunehmend „anstrengender” klangen. Dies lag auch daran, daß es die heutige „wohltemperierte” Stimmung von Musikinstrumenten noch nicht gab.
Musikinstrumente waren in einer Tonart gestimmt. Der Ton stand dann ruhig, ohne Schwebungen. Doch schon die Terz klang schräg und galt als Disharmonie.
«Eine Folge von reinen großen Terzen (Frequenzverhältnis 5:4) ist stimmtechnisch nicht in Übereinstimmung zu bringen mit einer Folge von reinen Quinten (Frequenzverhältnis 3:2). Bei der üblichen Beschränkung auf zwölf Tonstufen pro Oktave bedeutet dies, daß man Kompromisse eingehen muß: Je reiner eine bestimmte Tonart gestimmt wird, umso unreiner klingen andere Tonarten.» (https://de.wikipedia.org/wiki/Stimmung_(Musik))
Schlimmer wurde es, je weiter die Tonart sich im Quintenzirkel von jener entfernte, auf die ein Instrument gestimmt war. Klang ein Stück in a-Moll wie eine Offenbarung, weil die Orgel in a-moll gestimmt war, so konnte etwa ein Stück in gis-Dur unerträglich klingen, zum Schuhe-Ausziehen.
«Die zunehmende Chromatik in der Vokalpolyphonie erweiterte den Tonvorrat endgültig auf zwölf Töne. Das Dissonanzempfinden veränderte sich. Die Terz, im Mittelalter noch als dissonant eingestuft, wurde zum Harmonieträger im entstehenden Dur-Moll-System. Unterstützt wurde dieses Dissonanzempfinden allerdings dadurch, daß die Terz in der im Mittelalter verwendeten pythagoreischen Stimmung (Frequenzverhältnis 81:64) auch aus heutiger Sicht dissonant klingt; die reine große Terz (Frequenzverhältnis 5:4) kam erst mit dem Wechsel zur reinen Stimmung in das System.» (https://de.wikipedia.org/wiki/Stimmung_(Musik))
Daher war anfangs nur wenigen Intervallen erlaubt, gleichzeitig zu erklingen, weil die anderen als Disharmonie galten. Deshalb klingen viele frühe Versuche mit Polyphonie, also Mehrstimmigkeit, aus Spätmittelalter und Frührenaissance für unsere Ohren „hohl”. Allmählich wurden auch die kleine und die große Terz als Harmonie zugelassen. Als die „wohltemperierte” Stimmung erfunden wurde, klangen beide Terzen in allen Tonarten gut.
Nach der Verdrängung alter „heidnischer” Formen von Kultur und Musik entstand etwas völlig neues. Die Musik zeichnete sich durch „Kontrapunkt” aus. Das sind Regeln, wie verschiedene Melodielinien zu setzen sind, die gleichzeitig erklingen. Gleichzeitigkeit mehrerer Melodielinien ist etwas, das typisches Kennzeichen abendländischer Musiktradition wurde.
Auf im Takt betonten Noten durften nur Harmonien erklingen, alle zwischenzeitlichen Disharmonien waren aufzulösen. Nicht alle Disharmonien waren erlaubt; „schräg” klingende Töne wurden als unerträglich empfunden und widersprachen dem ursprünglichen Regelwerk, das sich im Laufe der Jahrhunderte ausbildete. Der „Tritonus” galt ursprünglich als diabolisch, hatte auf Hörer damals eine gewisse Schockwirkung.
«Gemäß den religiösen Konnotationen des „diabolus in musica” gilt im Barock das Tritonusverbot eigentlich nur noch in der Wiege und Zufluchtsstätte des stile antico: in der Kirchenmusik. Dennoch war für die allermeisten Komponisten vom 17. bis zum 19. Jahrhundert der Palestrinastil Inbegriff des „reinen Satzes”, die hohe Schule der Komposition schlechthin und seine Regeln von quasi-religiöser Aura umgeben.» (Thomas Mann, Doktor Faustus, herausgeg. von Werner Röcke)
Eine weitere Regel war, daß nicht alle Stimmen gleichzeitig nach oben oder nach unten laufen durften, was auf empfindliche Hörer wie ein Wegsacken oder Wegfliegen gewirkt hätte.
Menschen früherer Zeiten haben möglicherweise sehr empfindlich auf Klänge reagiert, die sie nicht gewohnt waren. Dazu habe ich einmal eine Anekdote gehört, die erfunden sein mag, aber bezeichnend ist, also mindestens gut erfunden:
«Ein Musiker in einem Ort hatte keine Ahnung von Musik, aber Musik komponiert, bei der er zwar die meisten Regeln des Kontrapunkts beachtete, jedoch vergaß, zwischen Harmonien und Disharmonien zu unterscheiden. So liefen die Zeilen zwar „kunstvoll” gegeneinander, doch in krassen, nie gehörten Dissonanzen. Bei der ersten Aufführung waren die Leute des Nachbarorts so aufgewühlt und schockiert, daß sie den „verrückten Kapellmeister” verprügelten. Die Leute seines Ortes verteidigten ihn, woraus ein Konflikt entstand, und fast hätte es wegen seiner Musik einen lokalen Krieg zwischen beiden Orten gegeben. Womöglich habe dieser „Verrückte” moderne Musik eines späteren Jahrhunderts vorweggenommen.»
Vielleicht ist das nur eine phantastische Erfindung, doch können wir eines daraus entnehmen: Die größere Sensibilität für Harmonien, und wie zuvor als dissonant geltende Intervalle nur allmählich salonfähig wurden.
«Ab dem Barock findet sich der Tritonus mit Regelmäßigkeit. … Obwohl der Tritonus nun aufgrund seiner Bezeichnung als diabolus in musica immer häufiger eingesetzt wurde, um „teuflische oder ähnlich widrige Sachverhalte oder Affekte zu charakterisieren”, büßte er außerhalb der genannten Akkorde seine Außergewöhnlichkeit kaum ein. Erst in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts und nach Wagner, mit dem außergewöhnliche Akkorde, Intervalle und Dissonanzen zu quasi alltäglichen Erscheinungen wurden, verlor er allmählich seine „teuflische Qualität”.» (Sebastian Berndt, Ein Versuch über Metal und Christentum)
Bachs Werk „Das wohltemperierte Klavier” verwendet erstmals alle möglichen Dur- und Molltonarten und wäre daher unspielbar in einer älteren Stimmung als der „wohltemperierten” oder der heute gebräuchlichen „gleichen Stimmung”. In früheren Stimmungen des Instruments hätten einige der Stücke aufgrund ihrer unpassenden Tonart zu schlecht geklungen. Andererseits klingen die Tonarten in moderner Stimmung gleich, was solchen Kompositionen einen Teil ihres Reizes nimmt, die mit dem unterschiedlichen Klang von Tonarten in älteren Stimmungen spielten.
Die Regeln des Kontrapunkts gipfelten in einer Technik, die namensgebend wurde: Die Kunst der Fuge. Dabei wurde dieselbe Melodie von allen Stimmen gespielt oder gesungen, aber zu einer verschiedenen Zeit. Wir hören also verschiedene Phasen derselben Melodie gleichzeitig.
Das strenge Prinzip ist der „Kanon”. Wir alle kennen ein „Volkslied”, „Hejo, spann den Wagen an. Denn der Wind treibt Regen übers Land.” Der strenge Kanon ist jedoch für Kunstwerke untauglich, weil es fast unmöglich ist, ein kompliziertes Werk nach so strengen Regeln zu schreiben und gut klingen zu lassen. Es gibt fast keine Melodie, die für einen vielstimmigen, langen und schönen Kanon taugt.
Deshalb setzte sich statt des Kanons die Fuge durch, bei der die Stimmen sich im weiteren Verlauf unterscheiden dürfen. Im Idealfalle sind die Unterschiede eher gering ‒ hier mal einen Halbton höher, dort ein wenig dem ursprünglichen Verlauf nacherfunden.
In der barocken Musikkunst, und ganz besonders bei der reinsten und schwierigsten Form des Kontrapunkts, der Fuge, haben wir keinerlei Schlagzeug mehr, das im Frühbarock (etwa Purcell) noch ab und an einzelne, sehr einfache, für uns „langweilig” simpel klingende Rhythmen einlegen durfte bei königlicher Musik. Alles wird nunmehr durch Harmonien und Stimmführung erreicht. Es ist eine sehr intellektuelle Musik, komponiert, erdacht, und schwierig.
Der Höhepunkt dieser Blüteform abendländischer Polyphonie, des Kontrapunkts, hat einen Namen: Johann Sebastian Bach. Kein Kenner bezweifelt, daß es keinen Komponisten vor, während seiner Lebenszeit oder nach Bach gegeben hat, der dermaßen kunstvolle, lange und dabei hervorragend klingende Fugen komponieren konnte.
So schöne Einfälle die anderen großen Barockmeister hatten: Vivaldi, Händel, Telemann, keiner konnte solche Fugen und solche einen komplexen Kontrapunkt schreiben. Für mich klingen andere Barockkomponisten im direkten Vergleich „flacher”, ihre Kompositionen durchsichtiger, weil die Stimmenführung einfacher und „gröber” ist.
Ein Hauptwerk Johann Sebastian Bachs, von dem leider keine Oper überliefert ist, nennt sich „Die Kunst der Fuge”. Eine dieser Fugen kann rückwärts gespielt werden und klingt dann auch wunderbar. Sie kann gespiegelt werden ‒ jede Bewegung zu höheren Tönen geht nach unten zu tieferen, und umgekehrt. Wieder klingt die Fuge wunderbar. Spaßeshalber kann die Fuge auch gleichzeitig rückwärts und gespiegelt gespielt werden. Wieder ergibt sich ein Meisterwerk.
Bach bearbeitete auch im anbrechenden Rokoko modern werdende chromatische Melodien und Tonfolgen, die damals als „empfindsam” galten, doch brach er die Fuge rasch ab, weil er wohl merkte, in welch dem Barock fremde Harmonien das führte. Zweihundert Jahre später nahm Reger die Fackel an der Stelle wieder auf, wo der Meister sie niedergelegt hatte, schuf chromatische Sätze mit „modernen” Harmonien.
Johann Sebastian Bach hat jemand eine Intelligenz wie Einstein nachgesagt. Ich habe keine Ahnung, ob etwas daran ist, aber wundern täte es mich nicht.
Georg Friedrich Händel mag am Hofe des Königs begeistert haben. Doch wenn es Engel gäbe, würden sie wohl Bach singen. Trotz des „mathematischen” Satzes sind seine Stücke musikalisch packend. Eine Empfehlung: „Schweig, schweig, aufgetürmtes Meer!” Die Arie ist lautmalerisch und packend, obwohl die Musikstimmen kunstvoller selbständig laufen als bei anderen.
Nach Bach war das Barockzeitalter beendet. Vom Gipfel des Kontrapunkts bewegte sich die Musik nun wieder hinab. Die strengen Formen lösten sich auf. Bereits die nächste Epoche, die Klassik, experimentierte mit vielen neuen Effekten. Wo in der Fuge selbständige Stimmen liefen, gab es nunmehr begleitende Stimmen, Wiederholungen. Andererseits wurde immer mehr möglich: Freier Fluß der Ideen, die nur der Intuition folgen, aber nicht den einst genauen Regeln. Immer mehr Intervalle wurden als akzeptabel empfunden.
Die Art der Komplexität von Musik änderte sich. Für Bach war die bereits aufkommende Frühmoderne „keine Kunst”, weil sie die Komplexität seines reinen Kontrapunkts aufgab. Aus Sicht heutiger Musiker hat die Komplexität zugenommen, weil nunmehr eine Vielzahl individueller Ausdrucksmöglichkeiten entstand, die uns im strengeren Kontrapunkt Bachs kaum möglich erscheint. Man könnte daher zu deuten versuchen, die „mathematischere” Komplexität des Kontrapunkts sei im Barock, besonders bei Bach, auf ihrem einsamen Gipfel angelangt gewesen, wogegen eine andere Komplexität im Sinne vielfältiger Ausdrücksmöglichkeiten seitdem enorm zugenommen habe.
Wir könnten aber mutmaßen, daß sich in dieser unterschiedlichen Deutung durch Bach und heutige Musiker eine Verschiebung von einem „abstrakten Regelwerk des Kontrapunkts” hin zu einem Individualismus ergeben habe, der musikalisch letztlich eine gesellschaftliche Entwicklung zu einer individualistischen, heute gar hedonistischen Gesellschaft widerspiegele. Die Lockerung der Regeln brachte zunächst die heute Klassik genannte Epoche, von vielen als eine Blütezeit gedeutet. Doch am Ende stand die Auflösung der Tonalität. Da jedes Intervall zu jedem Zeitpunkt zulässig war, verlor sogar die Tonart ihre Bedeutung. Wenn alles erlaubt ist, haben wir Beliebigkeit. Das ist anstrengend. Atonale, moderne Klassik tat sich schwer, Hörer zu finden. Klassische Musik verlor ihre Bedeutung, wurde zur Nischenerscheinung.
Weiter könnten wir spekulieren, daß wie in der Gesellschaft, so auch in der Musik gälte, daß die Aufhebung aller Regeln und ein grenzenloser Individualismus irgendwann zur Auflösung führt, ob der Gesellschaft, oder der Musiktradition.
Die meisten Menschen wechselten zu populärer Musik. In dieser nahm die Bedeutung des Rhythmus (z.B. des Schlagzeugs) immer weiter zu, der auf dem Höhepunkt des Kontrapunkts fast völlig vernachlässigt worden war, nur noch in Form von Takt und Melodie bestand.
Interessanterweise wurde neue Musik stark vom Jazz geprägt. Vom Dixieland, einer Frühform des Jazz, heißt es, er habe auch auf den Regeln des Kontrapunkts basiert, aber anderen Harmonien, mit „afrikanischen” Wurzeln. Das schließt an unsere Anekdote von vorhin an. Auch im Jazz lösten sich die Formen auf, er wurde später zum „free jazz”, der auf viele auch anstrengender wirkt als der frühe.
Einflüsse von Jazz, Swing, Blues, Zigeunermusik und andere ethnische Einflüsse schufen eine neue Musikrichtung und Entwicklung, in der Rhythmen immer tonangebender wurden, die Bedeutung von Harmonie und Mehrstimmigkeit abnahmen.
Die Beatles waren vielleicht deswegen so erfolgreich, weil ihre Lieder im Chorus noch leichte Ansätze von Mehrstimmigkeit hatten, die sie aus der Menge hervorhoben. Später wurde die noch melodiegetragene Musik der 1960er zunehmend von erst Diskorhythmen, dann Hiphop, House, Rave, Goa, Rap und anderen Richtungen verdrängt, in denen der Rhythmus das entscheidende ist, Melodie überflüssig, Beiwerk, oft nur in Bruchstücken oder gar nicht vorhanden ist.
Damit hat die Musik einen Schwenk von einem Extrem ‒ der Fuge und dem Kontrapunkt, reiner Melodie und Harmonie, zum anderen Extrem ‒ treibende Rhythmen ohne Melodie gemacht.
Kopflastige, mathematisch komponierte Musik wurde ersetzt erst durch Improvisition, dann durch gemischte Musik, die nicht mit Musikinstrumenten produziert, sondern beim Tanz elektronisch gemischt wird. „All you need is bass”, heißt die Schlagzeile auf einem beliebten T-Hemd der Szene, womit ein hämmernder Baßrhythmus gemeint ist, der nicht nur hörbar sein, sondern vom Körper gefühlt werden soll.
Manche haben die treibenden, entscheidenden Rhythmen von House, Trance, Rave oder Goa mit urzeitlichen, schamanischen Rhythmen verglichen, die angeblich der sozialen Organisation dienten. Ich weiß nicht, ob an solchen Spekulationen etwas dran ist. Ebensowenig wollen wir spekulieren, ob der Rückgriff auf schamanische Trancerhythmen etwas mit dem Zusammenbruch traditioneller Strukturen von Kultur und Zivilisation zu tun haben könnte. Bei diesem Deutungsmuster wären wir auf einen Zustand vor Entstehen der Zivilisation zurückgeworfen.
Die Musik ist im Laufe der Entwicklung unserer Zivilisation abenteuerliche Wege gegangen. Um die Weite dieses Weges zu ermessen, mag es gut sein, einmal bei Johann Sebastian Bach hineinzuhören.


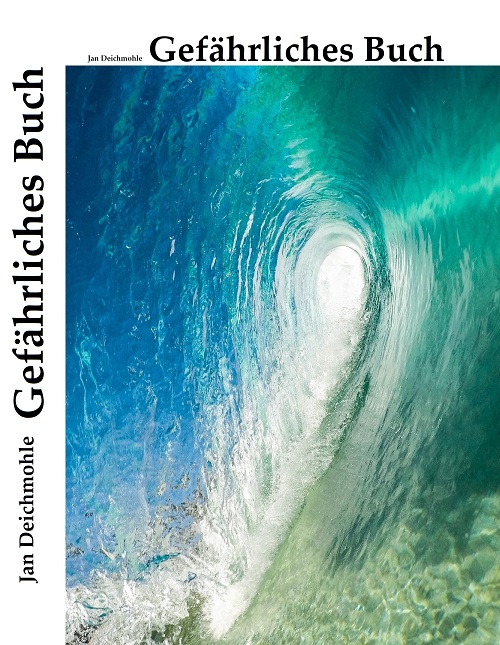



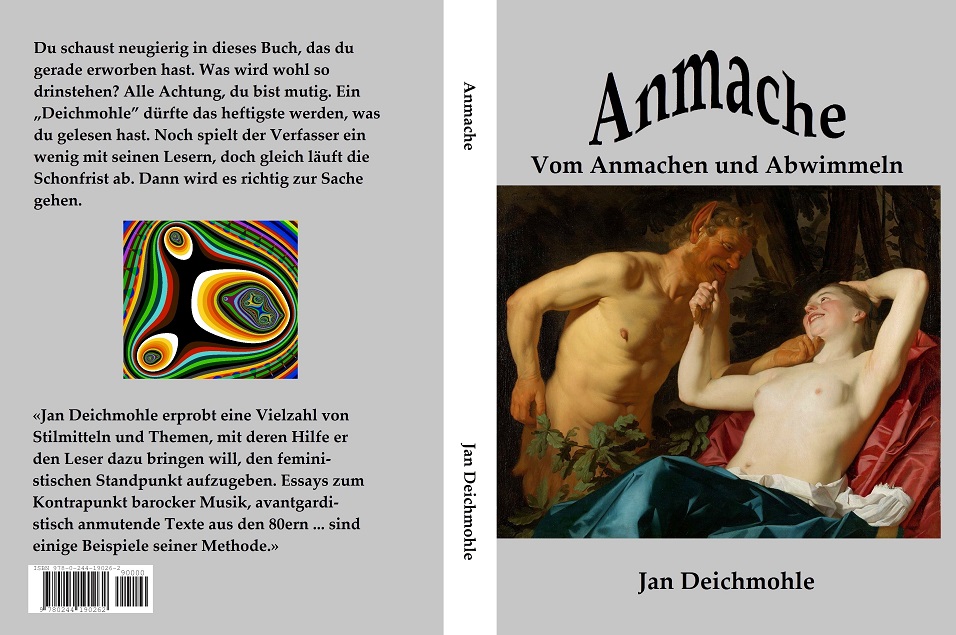
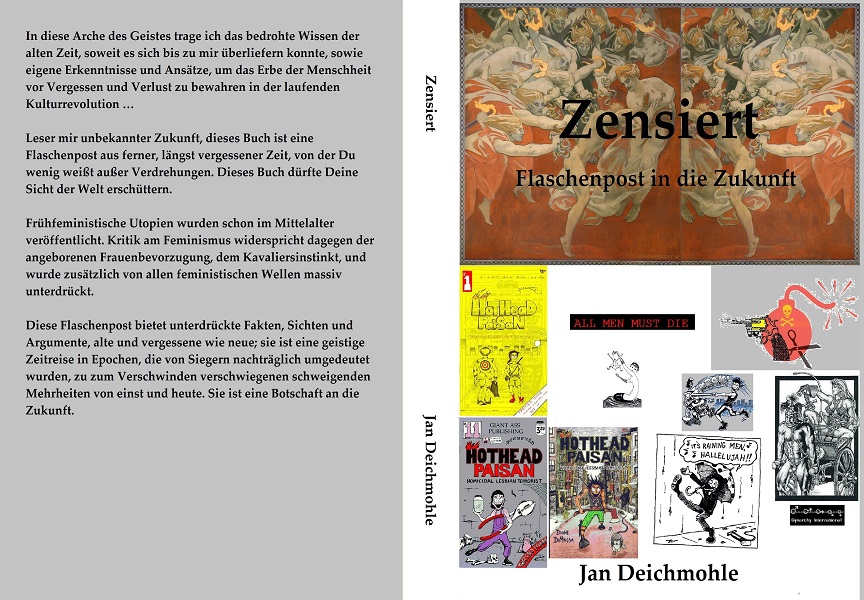




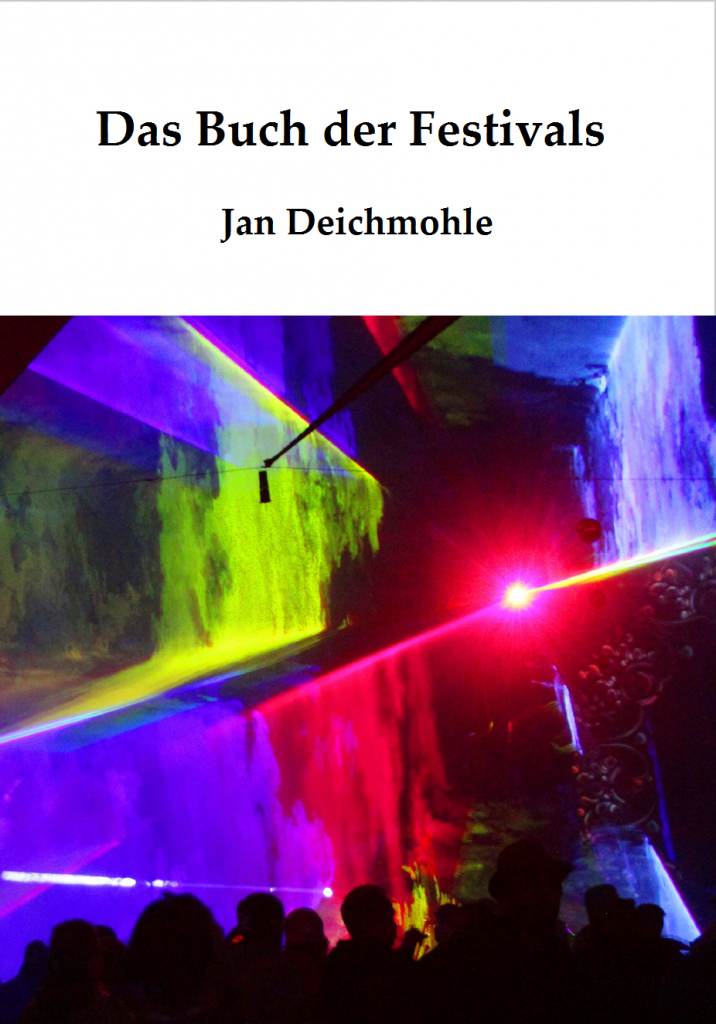


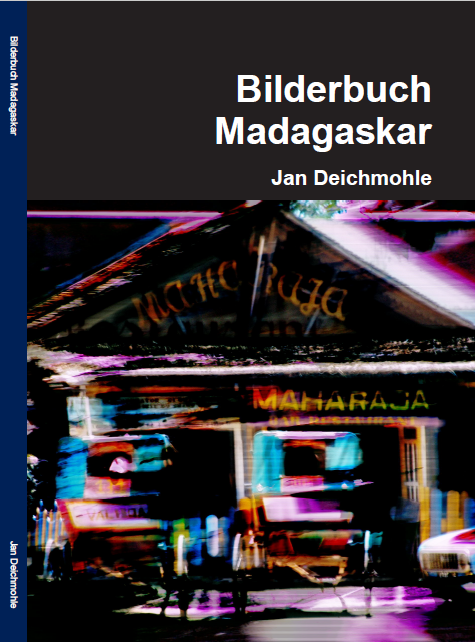




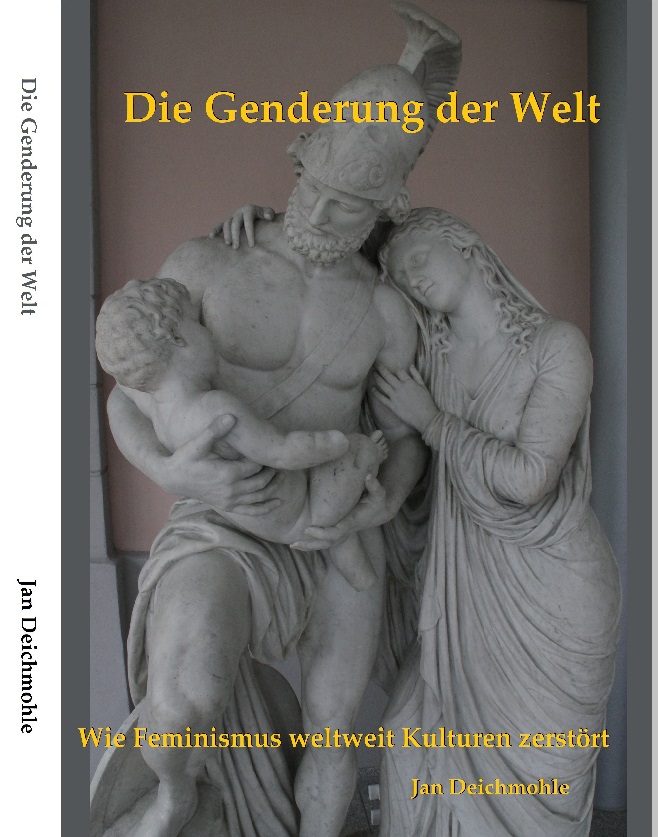
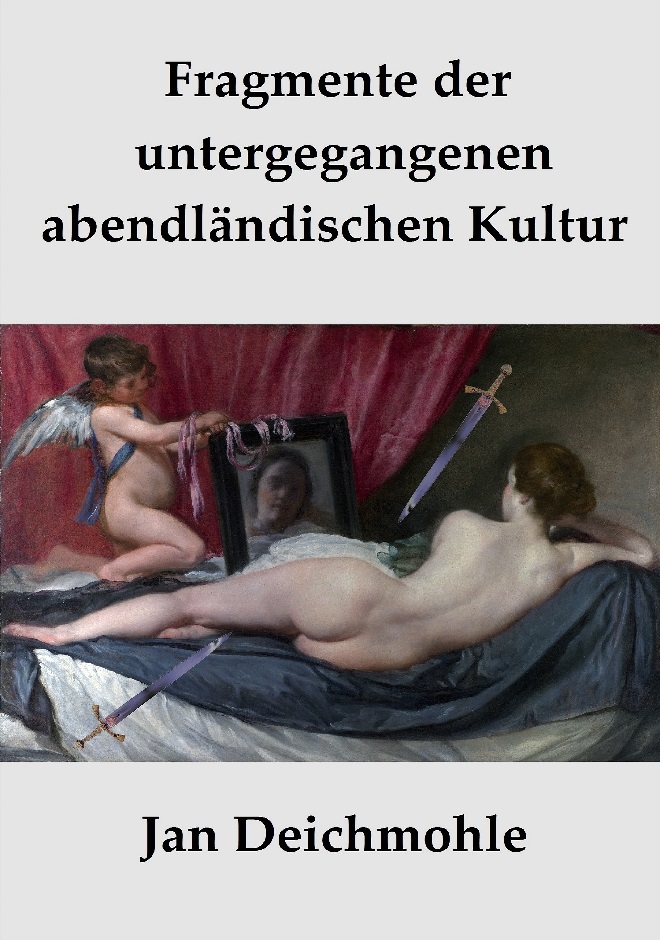
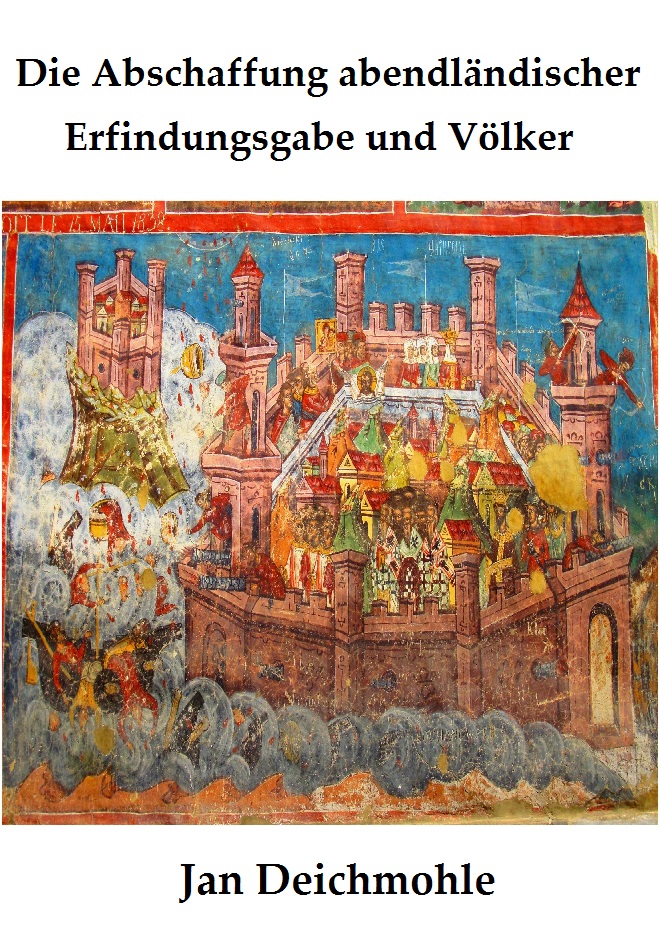
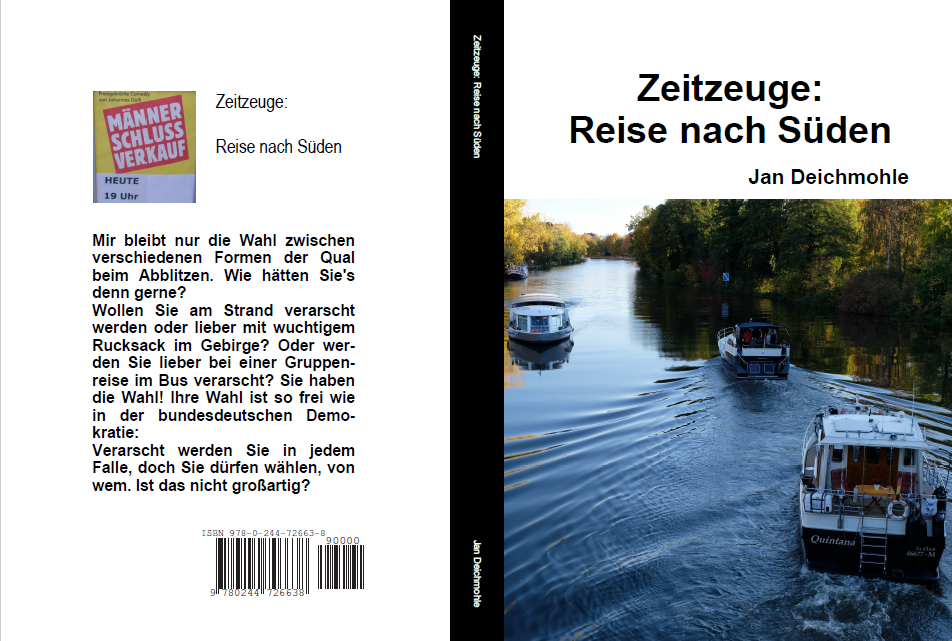



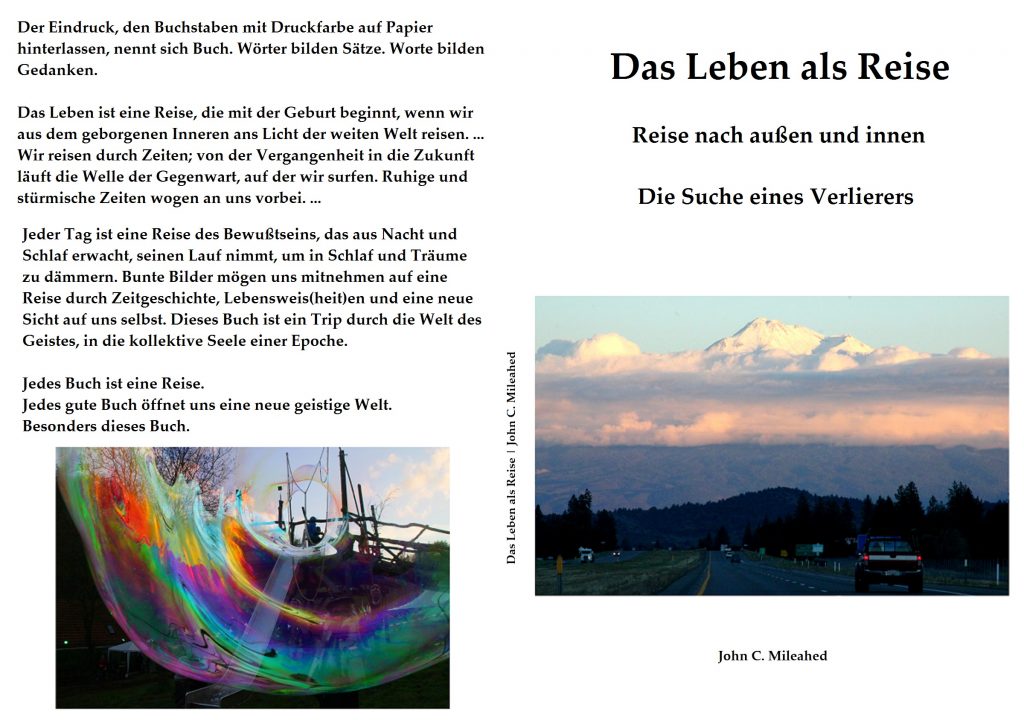

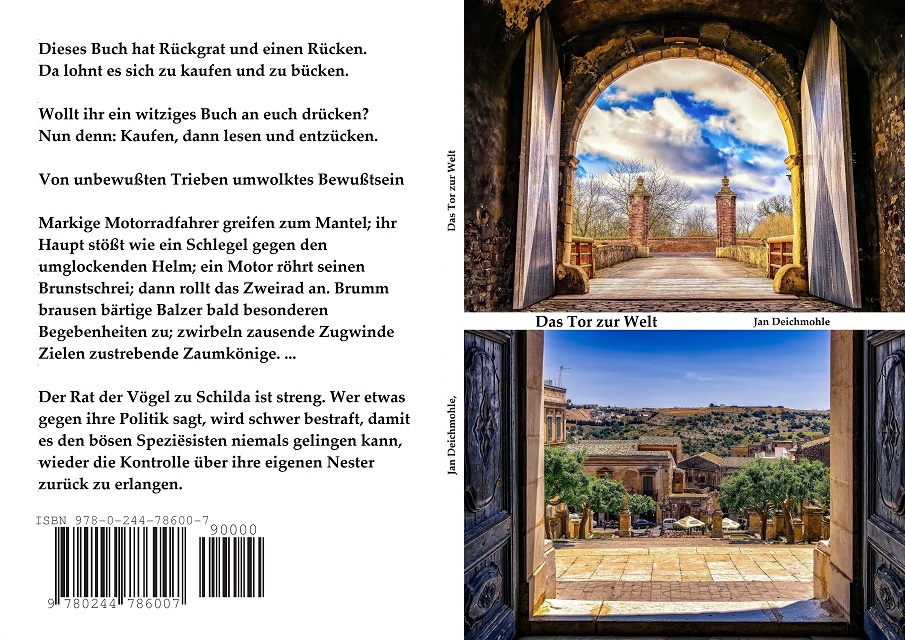


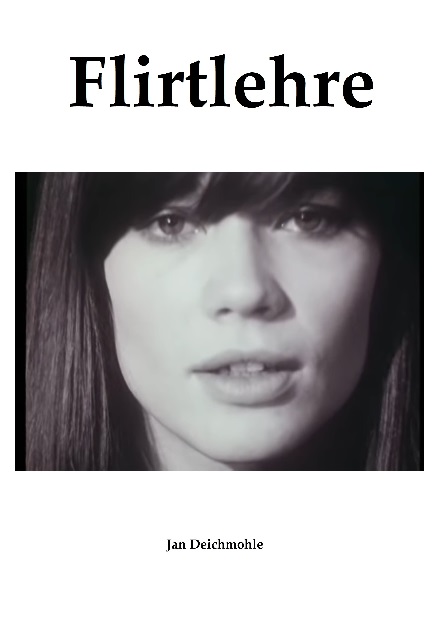
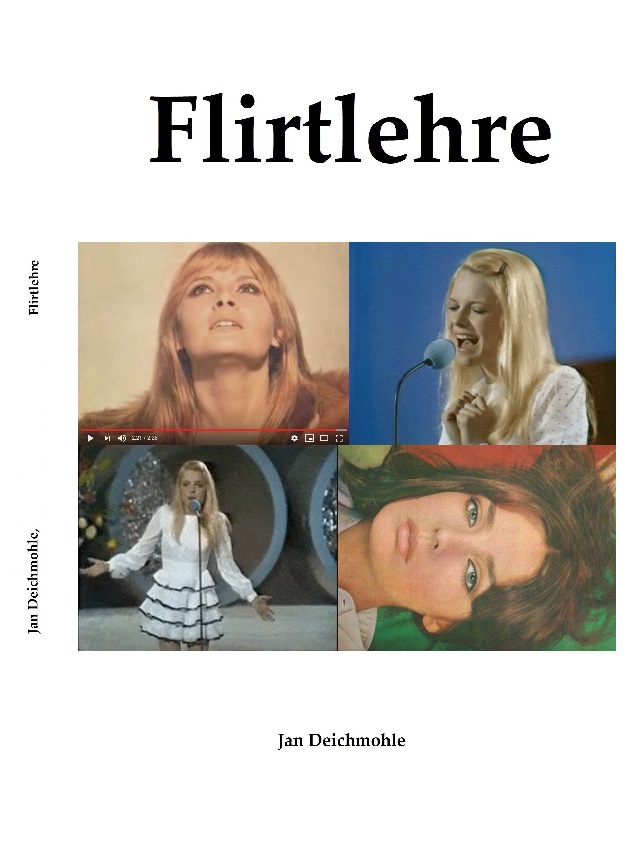
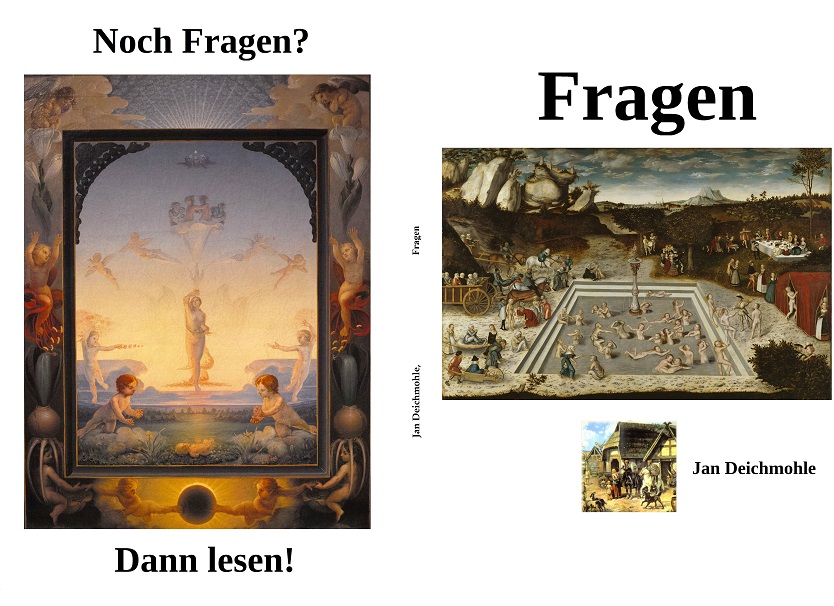
Schreibe einen Kommentar